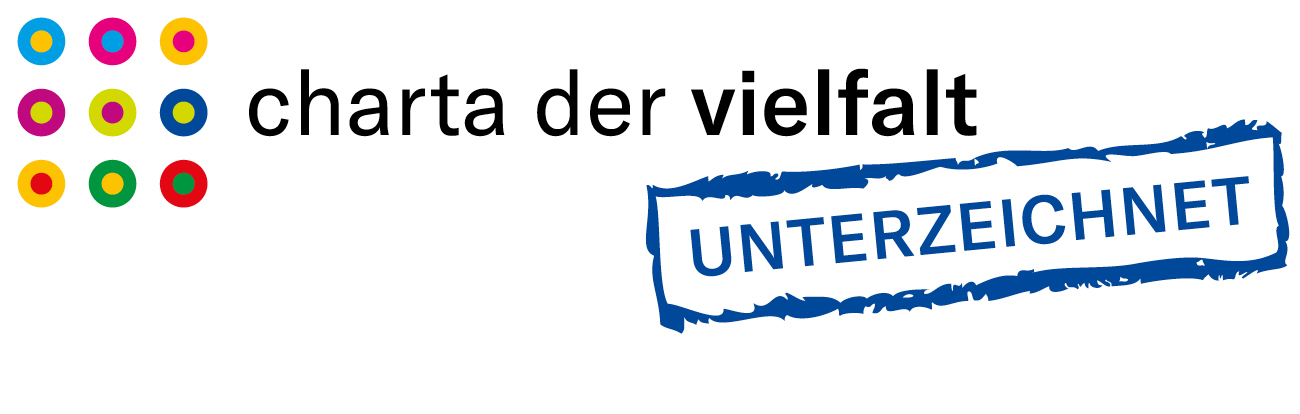Diese Arbeit ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem PDI und Forschenden des Instituts für Optische Sensorsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR, Berlin), des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie (INP, Greifswald) sowie der Lytid SAS (Orsay, Frankreich). Der Beitrag gibt einen Überblick über das Design, die Herstellung und die praktische Anwendung fortschrittlicher Terahertz- (THz-) Quantenkaskadenlaser (QCLs), mit besonderem Fokus auf die hochauflösende Terahertz-Spektroskopie. Das PDI verfügt über eine langjährige Expertise in der Entwicklung und Bereitstellung von THz-QCLs für praxisnahe Anwendungen.
Die in dieser Studie untersuchten Laser ermöglichen den Dauerstrichbetrieb in mechanischen Kühlsystemen und erreichen Ausgangsleistungen von bis zu 10 mW. Kürzlich wurden zudem Laser mit Emissionen unterhalb von 3 THz entwickelt. In die kompakten kommerziellen Terahertz-Systeme von Lytid integriert, dienen diese Laser als vielseitige Strahlungsquellen für den Spektralbereich von 2,5 bis 4,8 THz.
QCLs sind konkurrenzlose Strahlungsquellen für die hochauflösende Terahertz-Spektroskopie, die auf Feinstruktur- und Rotationsübergängen in Atomen und Molekülen basiert. Beispielsweise emittiert und absorbiert der Feinstrukturübergang 3P1 → 3P2 im neutralen atomaren Sauerstoff (OI) elektromagnetische Strahlung mit einer Ruhefrequenz von 4,744777 THz, während der Rotationsübergang 1F5/2 → 1F7/2 des Hydroxylradikals (OH) bei 3,551192 THz liegt. Laser mit geeigneten Frequenzen und Abstimmungsbereichen, die am PDI entwickelt wurden, sind von unseren Partnern am DLR und INP erfolgreich in Heterodyn- bzw. Absorptionsspektrometer integriert worden.
Ein aktuelles DLR-Instrument, das einen QCL als Lokaloszillator nutzt, ist OSAS-B – ein Heterodyn-Empfänger zur Beobachtung der 4,75-THz-Emission von atomarem Sauerstoff in der Mesosphäre und unteren Thermosphäre. In diesem System arbeitet der Laser auf einer mit flüssigem oder festem Stickstoff gekühlten Stufe. Aufgrund der starken Wasserabsorption in der Troposphäre erfolgen die Messungen von einer stratosphärischen Ballongondel aus. Die aufgezeichneten Spektren zeigen eine charakteristische Flügelstruktur, die aus Absorptions- und Emissionswechselwirkungen in atmosphärischen Schichten mit starken Temperaturgradienten resultiert.
Am INP konnten Forschende die Dichte von atomarem Sauerstoff in Plasmen präzise bestimmen, indem sie den Feinstrukturübergang von atomarem Sauerstoff in einem kapazitiv gekoppelten Hochfrequenz-Sauerstoffplasma detektierten. Die THz-Absorptionsspektroskopie wurde mit einer etablierten, aber komplexen und kostspieligen Methode – der Laser-induzierten Zweiphotonen-Absorptions-Fluoreszenz – verglichen und zeigte hochgradig konsistente Ergebnisse. Diese Validierung unterstreicht das Potenzial der QCL-basierten Absorptionsspektroskopie für praktische Anwendungen, insbesondere in der Mikroelektronikindustrie.