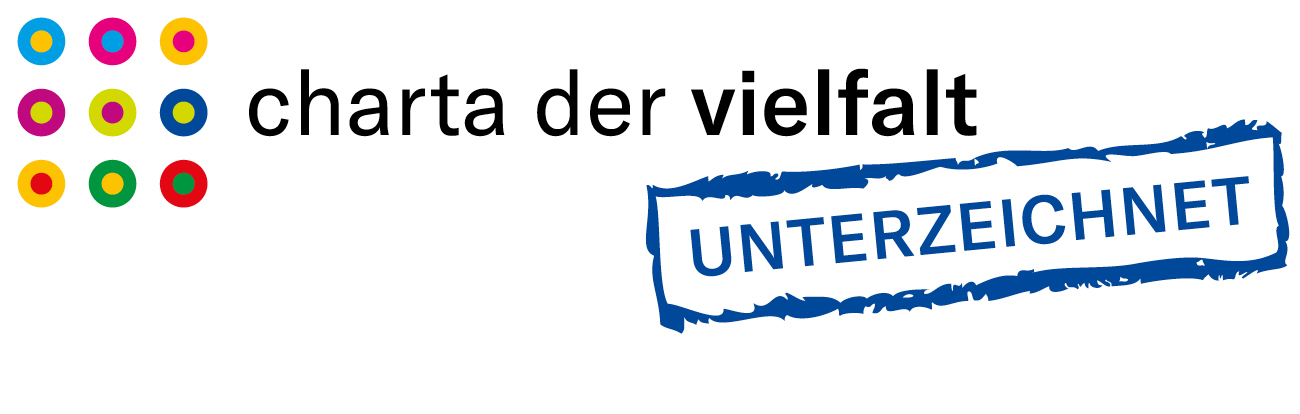Die Versorgung mit Strom und Energieträgern ist in unserer Gesellschaft so selbstverständlich, dass man sie vor allem dann wahrnimmt, wenn sie nicht perfekt funktioniert. Dabei gibt es viele Dinge, die für eine reibungslose Versorgung zusammenkommen müssen. Noch dazu sollen etwa Strom und Gas nicht zu teuer sein. Im Rahmen der Energiewende wird hierbei vor allem Gas eine entscheidende Rolle spielen. Denn unter den fossilen Energieträgern ist Erdgas derjenige, der am wenigsten Treibhausgasemissionen verursacht. Und er eignet sich nicht nur zur Heizung, sondern soll auch in schnell regelbaren Gaskraftwerken helfen, die Einspeiseschwankungen von Solar- und Windkraft auszugleichen.
Zudem soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten grüner Wasserstoff Schritt für Schritt das fossile Erdgas ersetzen. „Den Gasnetzen kommt deshalb eine zentrale Rolle bei der Energiewende zu“, sagt René Henrion vom Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin. Der Mathematiker ist an mehreren Projekten zur Optimierung von Gas- und Stromnetzen beteiligt, auch mit internationalen Partnern.
Dabei steht die Entwicklung neuer mathematischer Methoden im Vordergrund – und es ergeben sich durchaus auch überraschende neue Erkenntnisse. „Wie es in der Mathematik oft so ist, lassen sich die entwickelten Verfahren auch auf anderen Gebieten einsetzen“, erklärt Henrion. „So haben wir zum Beispiel gesehen, dass unsere Optimierungsverfahren sich nicht nur für Gasnetze eignen, sondern durchaus auch zur Behandlung kleinerer Stromnetze.“ Zwar ist das Stromnetz in Deutschland in das europäische Verbundnetz eingebunden und damit zu groß für eine derartige Betrachtungsweise. „Aber in Afrika gibt es vielerorts kleinere, lokale Stromnetze, die auch als Mini-Grids bezeichnet werden und für die unsere Optimierungsverfahren ebenfalls infrage kommen.“
Die Forschungsaktivitäten zur Optimierung von Gasnetzen am Weierstraß-Institut sind im Sonderforschungsbereich Transregio 154 gebündelt und umfassen eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Problemstellungen und Herangehensweisen. „Der Forschungsbereich geht auf eine alte Kooperation mit Industriepartnern zurück, bei der eine konkrete Problemstellung untersucht wurde“, sagt Henrion. „Allerdings blieben am Ende des Projekts vor über zehn Jahren noch einige mathematische Fragen offen, so dass wir am Weierstraß-Institut gemeinsam mit den anderen beteiligten Institutionen dieses Forschungsgebiet auch wegen seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dann konzentriert aufgebaut haben.“
Dabei geht es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darum, den Gastransport im Netz zu modellieren, simulieren und optimieren. In regionalen Gasnetzen gibt es eine Vielzahl von Rohrleitungen, dazu kommen noch etliche Einspeisepunkte von überregionalen Netzen und hunderte von Verteilerstationen – etwa in Städten und Dörfern –, aus denen Gas entnommen wird. Außerdem werden Pumpen und Kompressorstationen benötigt, die für den notwendigen Druck in den Gasleitungen sorgen.
„Bei der Optimierung all dieser Punkte ist außerdem zu berücksichtigen, dass zahlreiche Modellparameter von Natur aus unsicher sind. So können sich Angebot und Verbrauch ständig ändern, denn ein kalter Tag sorgt etwa für erhöhte Nachfrage“, erklärt Henrion. Damit ändern sich auch die Preise, was wiederum die Nachfrage beeinflusst. Externe Parameter wie das Wetter oder auch technische Kenngrößen wie die Rauigkeit der zum Teil schon jahrzehntealten Pipeline-Röhren lassen sich bei einer mathematischen Modellierung nicht exakt bestimmen. Deshalb bezeichnet man solche Forschungsprojekte auch als „Optimierung unter Unsicherheit“.
„Ein wichtiges Ziel der Forschungsarbeit ist es zu demonstrieren, dass sich mit unseren mathematischen Verfahren die Energiesicherheit erhöhen lässt“, sagt Henrion. „Dazu nutzen wir unter anderem Methoden der stochastischen Optimierung, wo sich Optimierung und Wahrscheinlichkeitsrechnung treffen. Ich persönlich arbeite insbesondere mit sogenannten Wahrscheinlichkeitsrestriktionen. Bei diesen soll gelten, dass ein bestimmtes Ziel, hier die sichere Gasversorgung, auch unter unsicheren Bedingungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingehalten wird.“
Wie sich interessanterweise ergeben hat, lassen sich mit diesen Methoden nicht nur Gasnetze optimieren. „Eine ehemalige Doktorandin und ein Kollege stehen mit Forschern in Afrika in Kontakt, um dort bei der Optimierung von kleinen Stromnetzen zu helfen“, erzählt der Forscher. Gerade in der Sahelzone besteht die Schwierigkeit, dass das große Verbundnetz nur unregelmäßig Strom liefern kann und es regelmäßig zu Stromausfall kommt. Stattdessen sollen sogenannte Mini-Grids – also lokale und kleine regionale Stromnetze – für eine möglichst unterbrechungsfreie Stromversorgung sorgen.
Diese Mini-Grids basieren oft auf Solarzellen, die aber nur tagsüber Strom liefern, sowie Batteriespeichern und Dieselgeneratoren. Letztere brauchen teuren Dieseltreibstoff und sollen deshalb nur dann anspringen, wenn sich auf andere Weise kein Strom bereitstellen lässt. „Eine zentrale Frage bei der Optimierung solcher Stromnetze ist nun, wie viel Strom man etwa zum Aufladen der Batterien zusätzlich zum Solarstrom aus dem Hauptnetz importieren soll, solange dieses stabil ist“, erklärt Henrion.
Ganz gleich, ob es sich bei einem Energiespeicher um eine Batterie, um ein Wasserkraftwerk oder um ein Gasreservoir handelt: Bei der Einsatzplanung lassen sich ähnliche mathematische Modelle anwenden. Unter anderem zu Wissenschaftlern in Tansania und Äthiopien bestehen bereits Kontakte, die hoffentlich in Zukunft zu spannenden Projekten führen werden. „Wir versuchen grundsätzlich, unsere Forschung mit einem Auge auf den gesamtgesellschaftlichen Nutzen auszurichten“, schließt Henrion. „Und umso schöner ist es natürlich, wenn sich unsere Arbeit auch in Entwicklungsländern nutzbar machen lässt.“
Dirk Eidemüller