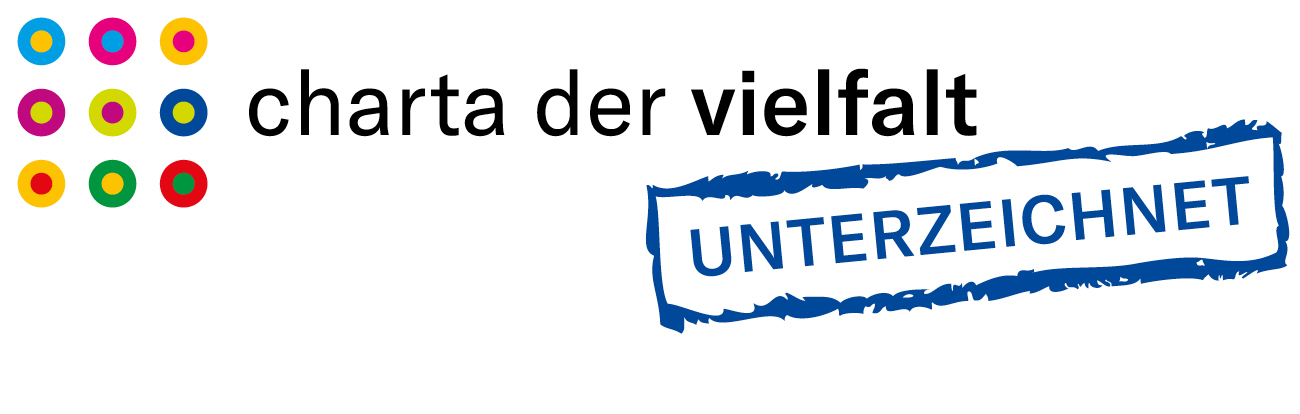Das Gespräch führte Patricia Löwe am 5. März 2025.
Patricia Löwe: Sie waren 2005 die fünfte Frau, die mit dem Marthe-Vogt-Preis des Forschungsverbunds Berlin e. V. ausgezeichnet wurde, der damals noch Nachwuchswissenschaftlerinnen-Preis hieß. Sie waren 31 Jahre alt. Wie war damals Ihre Situation als junge Wissenschaftlerin?
Astrid Vogel: Als ich 30 Jahre alt war, hatte ich meine Doktorarbeit an der Humboldt-Universität am Institut für Verhaltensphysiologie abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Arbeit war neurobiologisch. Dann wurde ich von meinem Doktorvater Prof. Dr. Bernhard Ronacher für diesen Preis vorgeschlagen. Zeitgleich habe ich mich nach einer Postdoc-Stelle umgesehen. Ob ich in der Wissenschaft bleiben wollte, wusste ich noch nicht genau. Ich hatte einen starken Familiengründungswunsch – ein Jahr zuvor hatte ich geheiratet.
PL: Wussten Sie schon als Studierende, dass Sie promovieren wollten?
AV: Am Ende das Studiums auf jeden Fall. Nach meiner Diplomarbeit mit Mitte 20 war ich ein Jahr lang in der Abteilung meines späteren Doktorvaters tätig, ohne dass ich mein Promotionsstudium schon begonnen hätte. Fünf Jahre später hatte ich meinen Abschluss.
PL: Warum sprach die Familiengründung gegen die wissenschaftliche Karriere?
AV: Für mich problematisch waren weder befristete Verträge noch das Wissenschaftszeitgesetz. Mich hat eher der Publikationsdruck abgeschreckt, unter dem man arbeitet. Auch Naturwissenschaftler*innen muss das Zusammenschreiben von Ergebnissen mehr oder weniger leicht von der Hand gehen, damit sie ausreichend publizieren können. Sonst ist es eine Quälerei. Ich habe meine Dissertation durchaus gern geschrieben, aber ich wollte das nicht ewig machen. Großen Spaß hatte ich an der Lehre!
PL: Worum ging es in Ihrer Dissertation?
AV: Ich habe meine Dissertation für das Interview extra aus dem Keller geholt! (lacht) Der Titel lautet: „Die neuronale Variabilität und Korrelationen als begrenzende Faktoren für die Verarbeitung und Kodierung zeitlich strukturierter akustischer Signale“. Es ging um das Kommunikationsverhalten von Grashüpfern – das waren meine Versuchstiere. Wenn sie im Gras sitzen, müssen sie ihre Artgenossen finden; das geschieht über akustische Signale. Das Nervensystem der Grashüpfer ist nicht so komplex wie das höherer Vertebraten. Deshalb lässt sich dieses System gut untersuchen. Ich habe mir angeschaut, wie neuronale Filtermechanismen dabei helfen, bestimmte Signalparameter zu erkennen. Stellen Sie sich vor, dass fünf verschiedene Arten von Heuschrecken in einer Wiese sitzen, die jeweils ihre passenden Männchen und Weibchen erkennen müssen. Die Signale der Arten unterscheiden sich. Ich habe untersucht, welche Neuronengruppen dafür verantwortlich sind, diese Unterscheidungen zu erkennen.
Akustische Signale kann man von den Nerven der Grashüpfer mit einer kleinen Mikroelektrode ableiten. Es sind elektrische Signale, die man auch sichtbar und hörbar machen kann. Das Hörorgan der Grashüpfer befindet sich im ersten Abdominalsegment – das Abdomen ist der Hinterleib. Von da führt der Hörnerv in kleine thorakale Ganglien, d. h. im Brustraum liegende Nervenknoten, in denen die ersten Verarbeitungsstufen stattfinden. Dort habe ich versucht, Zellen zu finden, die auf bestimmte Art und Weise auf die Signale reagieren. Das lässt sich dann mit einem elektronischen Messgerät namens Oszilloskop sichtbar machen.
PL: Was hat Ihnen der Nachwuchswissenschaflterinnen-Preis damals bedeutet?
AV: Das war eine wahnsinnig schöne Anerkennung. Eine Doktorarbeit kann ein ziemlicher Ritt sein. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich nie fertig werde, dass immer noch ein riesiger Berg vor mir liegt. Irgendwann hatte ich es aber wirklich geschafft. Das allein hat mich sehr glücklich gemacht. Aber dass ich dann diesen Preis gewonnen habe, war wirklich großartig. Es war aufregend, bei der Preisverleihung einen Vortrag zu halten; ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich unbedingt gern in der Öffentlichkeit präsentieren, aber es war eine tolle Erfahrung. Ich bin dafür extra früher aus dem Urlaub gekommen. (lacht)
PL: Heute sind Sie in einer Kinderwunschklinik tätig. Was hat Sie dorthin geführt?
AV: Ich bin nach der Doktorarbeit für einen Postdoc nach Hamburg gegangen. Relativ schnell war dann mein erstes Kind unterwegs. Mein Mann hatte eine Stelle in München gefunden und ich wollte mich neu sortieren. Also habe ich mich dort als Embryologin in einer Kinderwunschklinik beworben; das war 2007.
Inzwischen arbeite ich in einer anderen Klink, in der ausschließlich Frauen beschäftigt sind. Das ist wirklich schön und ich liebe meinen Beruf. Ich mache hier die Laborleitung und profitiere immer noch sehr von meiner Zeit als Wissenschaftlerin.
PL: Also zeugen Sie die Embryonen?
AV: Genau! Ich injiziere die Spermien in die Eizellen und kümmere mich um alles, was rund um diesen Vorgang wichtig ist. Es geht aber auch um Dokumentation und Patientenbetreuung. Uns ist es wichtig, dass die Patient*innen wissen, wer die Eizellen betreut, dass ein persönlicher Kontakt hergestellt wird. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt: „Jede Eizelle bekommt ein Gesicht.“
Natürlich ist das trotzdem ein sehr stressiger Beruf. Der Bedarf an Kinderwunschbehandlungen wächst, weil Frauen heutzutage lieber länger warten, um auch Karriere machen zu können. Wir haben viel zu tun – gerade in der urbanen Region. Dazu kommt, dass ich gern viel arbeite, auch nachmittags und am Wochenende, aber trotzdem unbedingt Zeit für meine Kinder haben möchte. Die Gleichzeitigkeit von Verantwortungen ist als Frau nicht immer leicht zu schultern. Es ist aber auch eine schöne Aufgabe, der ich mich mit Freude stelle.
PL: Was würden Sie jungen Frauen in der Wissenschaft raten?
AV: Ich rate jeder studierenden Frau, die sich eine Karriere als Wissenschaftlerin vorstellen kann, sich mit einem Thema zu beschäftigen, für das sie brennt. Nur dann lassen sich die Leidenschaft und die Energie aufbringen, bestimmte Schritte zu gehen: eine Doktorarbeit zu schreiben, die Karriereleiter zu erklimmen etc. Das Festhalten am echten fachlichen Interesse ist die Voraussetzung dafür, diesen Weg einzuschlagen. Wissenschaft ist nicht immer ein leichtes Arbeitsumfeld. Eine starke innere Motivation kann eine junge Wissenschaftlerin über Hürden tragen.