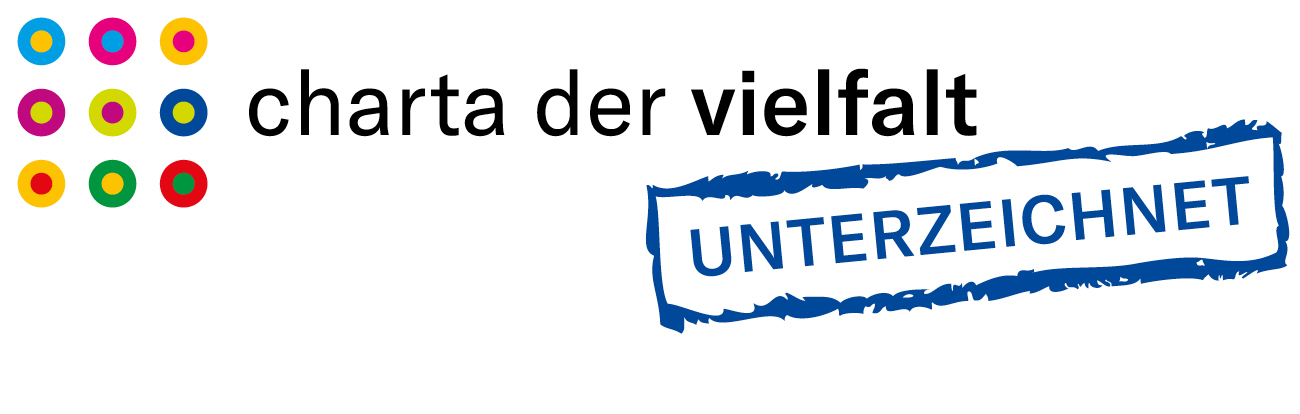Wo diese für einen effektiven Winterschlaf auf niedrige Temperaturen angewiesen sind, könnte die globale Erwärmung ihr Überleben beeinträchtigen. Ein Forschungsteam untersuchte nun, wie der Energieverbrauch der Fledermausart Großer Abendsegler von der Temperatur beeinflusst wird, und erstellte ein Modell, mit dem sich vorhersagen lässt, in welchen geographischen Breiten sie den Winterschlaf überleben und wie sich ihre Überwinterungsgebiete im Laufe der Zeit verändern könnten. Es zeichnet die Verschiebung der Überwinterungsgebiete in den letzten 50 Jahren exakt nach und sagt eine weitere Ausdehnung nach Nordosten um bis zu 14 Prozent des derzeitigen Verbreitungsgebiets bis zum Jahr 2100 voraus – bedingt durch kürzere und wärmere Winter in Europa.
Die Studie wurde am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) von einem wissenschaftlichen Team der Abteilungen für Evolutionäre Ökologie und Evolutionsgenetik durchgeführt. Die Erstautorin Dr. Kseniia Kravchenko ist jetzt Postdoktorandin an der Universität Luxemburg und die Seniorautorin Dr. Shannon Currie ist jetzt Dozentin an der Universität Melbourne. Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift „Ecology Letters“ veröffentlicht.
Der Energieverbrauch von Wildtieren ist eng mit der Umgebungstemperatur verknüpft. Wenn die Bedingungen ungünstig werden, können viele Säugetiere wie Fledermäuse Winterschlaf halten, um Energie zu sparen. „Winterschläfer werden in biophysikalischen Modellen oft übersehen, weil sie während des Winterschlafs zwischen zwei physiologischen Zuständen wechseln, was die Modellierung erschwert“, erklärt Shannon Currie. „Es ist also noch unklar, wie sich der Klimawandel auf diese Arten auswirken wird“.
Um zu untersuchen, wie sich der Klimawandel auf diesen wichtigen evolutionären Mechanismus auswirken könnte, führten Kseniia Kravchenko und ihre Kolleg:innen zwei Experimente durch: „Wir untersuchten, wie viel Zeit die etwa 30 Gramm schweren Großen Abendsegler bei verschiedenen Umgebungstemperaturen im Torpor – dem physiologischen Zustand, in dem sich die Tiere während des Winterschlafs befinden – verbrachten. Um den Torpor festzustellen, maßen wir die Hauttemperatur, denn die Tiere senken ihre Körpertemperatur, um Energie zu sparen“, erklärt Kravchenko. In einem zweiten Experiment maßen die Forschenden die CO2-Produktion als Indikator für den Energieverbrauch der Fledermäuse bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen.
Modelle zeichnen historische Verschiebung der Überwinterungsgebiete exakt nach
Die Ergebnisse der Experimente kombinierte das Team mit Prognosen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung für die tägliche Temperatur in verschiedenen Szenarien des Klimawandels. Auf diese Weise konnten sie das Energiebudget, das zum Überleben des Winters erforderlich ist, für mehr als 12.000 Standorte in ganz Europa berechnen. Sie verglichen die Energiebudgets auf der Grundlage historischer Daten (1901-2019) und mittels Prognosen für die Zukunft (2019-2100) in vier verschiedenen Klimawandel-Szenarien. „Unsere Berechnungen für aktuelle Temperaturdaten ergaben ein Überwinterungsgebiet, das der tatsächlichen räumlichen Verteilung dieser Gebiete sehr nahekommt. Das war beruhigend, denn unsere Modellierung erwies sich damit als sehr exakt, nur auf der Grundlage der Umgebungstemperatur und physiologischer Parameter. Wir waren auch deshalb zufrieden, weil es nach all den experimentellen Arbeiten und dem Programmieraufwand zeigte, dass unser Ansatz tatsächlich funktioniert“, sagt Dr. Alexandre Courtiol, Wissenschaftler und Modellierungsexperte am Leibniz-IZW. „Weitere Berechnungen ergaben, dass sich das Überwinterungsgebiet zwischen 1901 und 2018 in den Nordosten Europas verschob und damit um 6,3 Prozent seiner ursprünglichen Größe vergrößerte.“
Überwinterungsgebiete werden sich voraussichtlich weiter nach Norden und Osten verlagern und ausdehnen
Die Eingabe von verschiedenen Projektionen zukünftiger Klimaszenarien in das Modell zeigt, dass sich sowohl die südliche als auch die nördliche Grenze des potenziellen Überwinterungsgebiets weiter nach Norden verschieben könnte – die südliche Grenze sogar noch stärker als die nördliche. Seit 1901 haben sich die geeigneten Überwinterungsgebiete bereits um 260 Kilometer nach Norden verschoben. „Die derzeitige Ausbreitung nach Nordosten wird sich im Durchschnitt der Modelle um etwa 80 Kilometer fortsetzen, wodurch sich das potenzielle Überwinterungsgebiet zwischen 2019 und 2099 je nach Klimawandelszenario um 5,8 bis 14,2 Prozent vergrößern wird“, so die Forschenden. Im weitreichendsten Szenario des Klimawandels – bei dem mit einem Anstieg der Emissionen, einem Anstieg der Wintertemperaturen um 2,35 °C und einer Verkürzung der durchschnittlichen Winterschlafzeit um 41 Tage gerechnet wird – dürfte diese Nordverschiebung etwa 730 km betragen, sodass eine Gesamtverschiebung von etwa 990 km nach Norden innerhalb von 200 Jahren vorhergesagt wird.
Wie frühere Studien von Kravchenko und Kolleg:innen zeigten, sind Große Abendsegler in der Lage, ihr Verbreitungsgebiet innerhalb weniger Jahrzehnte um mehrere hundert Kilometer zu verlagern. Es ist also möglich, dass diese Art bei weiter steigenden Temperaturen den Veränderungen im potenziellen Überwinterungsgebiet in Europa folgt und dieses kontinuierlich in Richtung Nordosten erweitert. Dies könnte jedoch zu Problemen führen, wenn andere für den Winterschlaf erforderliche Faktoren wie ein geeigneter Winterschlafquartiere und das Vorhandensein von Nahrung vor Beginn des Winters in den neu erschlossenen Gebieten mit geeigneten Temperaturen nicht erfüllt sind.
Das wissenschaftliche Team fand heraus, dass die Winterschlafnische der Großen Abendsegler durch nur zwei einfache statistische Parameter angemessen erklärt und genau modelliert werden kann: die mittlere tägliche Umgebungstemperatur während der Winterschlafzeit und die Dauer des Winterschlafs. „Das bedeutet, dass wir möglicherweise die geeigneten Winterschlafgebiete anderer Arten anhand der gleichen Parameter kartieren könnten. Dennoch müssen wir die Auswirkungen des Klimawandels auf die Physiologie der Wildtiere noch genauer untersuchen und überwachen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Umweltfaktoren für erfolgreichen Winterschlaf und letztlich das Überleben von Arten vielfältiger und komplexer sind als nur die Umgebungstemperatur“, fasst Prof. Dr. Christian Voigt, Leiter der Leibniz-IZW-Abteilung für Evolutionäre Ökologie, zusammen. Diese ökophysiologische Forschung ist von entscheidender Bedeutung, um in Zeiten des Umweltwandels Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz von Wildtieren anzupassen.