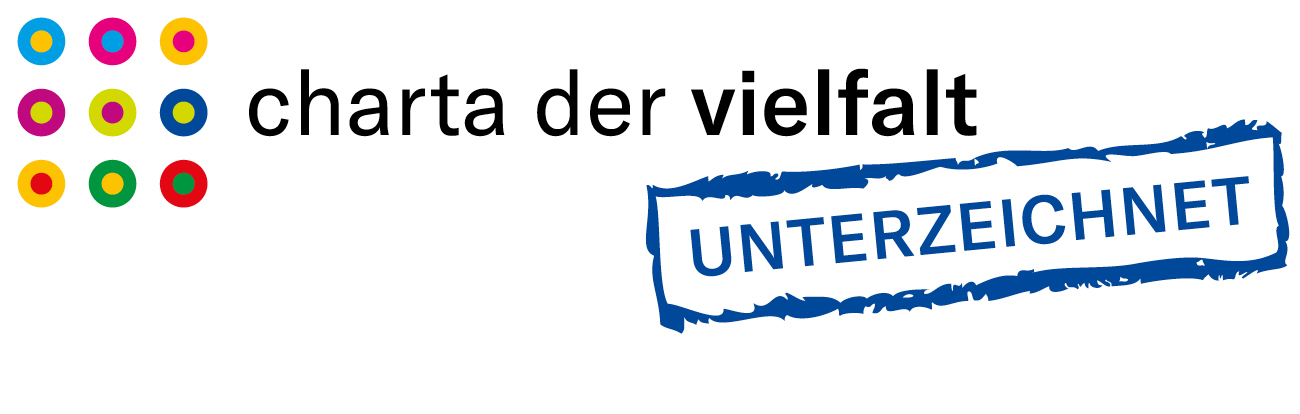Die Arten waren in der Vergangenheit sehr spezifischen Umweltbedingungen ausgesetzt – und sind heute mit unterschiedlichen Bedrohungen für ihren Fortbestand konfrontiert. In der Fachzeitschrift „Molecular Ecology“ legen Forschende des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) in Zusammenarbeit mit der brasilianischen NGO Instituto Tamanduá dar, dass B. crinitus, die derzeit stärker gefährdete Art, eine geringere genetische Vielfalt aufweist, bei B. torquatus jedoch ein rascher Anstieg der Inzucht in den letzten Jahrzehnten zu beobachten ist. Die Ergebnisse zeigen, dass Genomstudien wichtige Erkenntnisse für den Schutz gefährdeter Arten liefern können.
Vom 10. bis zum 21. November treffen sich conservation leaders aus aller Welt in Brasilien zur 30. Conference of the parties (COP30) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Das Land beherbergt mehrere Biodiversitäts-Hotspots von globaler Bedeutung, Regionen, die nicht nur eine große Artenvielfalt aufweisen, sondern auch zu einem stabilen Weltklima beitragen – wenn sie ausreichend geschützt werden. Eine neue Studie des Leibniz-IZW und des Instituto Tamanduá liefert wichtige Erkenntnisse für den Schutz der Biodiversität in den tropischen Wäldern Brasiliens.
Der Atlantische Regenwald „Mata Atlântica“, Südamerikas artenreicher tropischer Küstenwald, bedeckte einst große Teile von Brasiliens küstennahen Regionen. Aufgrund menschlicher Aktivitäten wie Rodungen für die Landwirtschaft und Urbanisierung sind heute nur noch etwa 8 Prozent seiner ursprünglichen Fläche erhalten. Auch wenn er stark reduziert und fragmentiert ist, dient der Mata Atlântica nach wie vor als Lebensraum für eine Vielzahl faszinierender – und widerstandsfähiger – Arten. Dazu gehören auch verschiedene Arten von Dreifinger-Faultieren, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind.
In enger Zusammenarbeit mit der brasilianischen Naturschutzorganisation Instituto Tamanduá gelang es Forschenden des Leibniz-IZW, die vollständigen Genome zweier eng verwandter Faultierarten aus dem Atlantischen Regenwald Brasiliens zu sequenzieren: des Kragenfaultiers (Bradypus torquatus) und seines südlichen Verwandten Bradypus crinitus. Sie leben in unterschiedlichen Regionen des Mata Atlântica. Das Genom einer Art entspricht ihrem genetischen „Bauplan“; bei der Genomsequenzierung werden die in der DNA enthaltenen Informationen in Daten umgewandelt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysieren können. Durch die Untersuchung der Genome der Faultiere konnten sie ermitteln, wie frühere Umwelt- und Klimaveränderungen und aktuelle menschliche Eingriffe in die Lebensräume die genetische Vielfalt, die Populationsgeschichte und den Erhaltungszustand der Arten beeinflusst haben.
Erkenntnisse aus der Genomik sind von großem Nutzen für den Artenschutz
Zentrale Ergebnisse der Genomanalysen zeigen, dass Bradypus crinitus, das derzeit stärker vom Aussterben bedroht ist, im Vergleich zu seinen nördlichen Verwandten eine geringere genetische Vielfalt und auch eine geringere historische Populationsgröße aufweist. Diese Eigenschaften des Genoms spiegeln die unterschiedlichen Umwelt- und Klimabedingungen wider, denen die beiden Regionen und die dort lebenden Faultiere in der Vergangenheit ausgesetzt waren.
Aber auch für das Kragenfaultier Bradypus torquatus, die nördliche der beiden Arten, ist die Lage besorgniserregend: Trotz seiner höheren genetischen Vielfalt und größeren aktuellen Population hat Inzucht durch die Paarung verwandter Individuen in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Dies ist wahrscheinlich auf die gegenwärtige Entwaldung und Fragmentierung seines Lebensraums zurückzuführen. Die Studie zeigt zudem, dass die nördliche Linie der beiden Dreifinger-Faultiere eine höhere genetische Belastung (d. h. mehr nachteilige Genvarianten) aufweist. Dies könne für die Population zur Gefahr werden, wenn sich der Trend des Rückgangs des Bestands nicht umkehrt. „Durch das Aufdecken wichtiger Aspekte der genetischen Gesundheit der Arten ermöglichen uns diese Erkenntnisse, Schutzmaßnahmen zu entwickeln, die wirklich auf das ausgerichtet sind, was die Arten am dringendsten benötigt“, sagte Larissa Arantes, Wissenschaftlerin am Leibniz-IZW, die die Arbeit leitete.
Diese wichtigen Erkenntnisse, die tief im Genom der Faultiere verborgen sind, zeigen, dass es für beide Arten jeweils individuelle Herausforderungen für ihren Schutz und Erhalt gibt, die sowohl durch tiefgreifende historische Umweltveränderungen als auch durch aktuelle Bedrohungen für ihren tropischen Lebensraum geprägt werden.
Untersuchung liefert konkret anwendbare Erkenntnisse für den Arten- und Umweltschutz
Diese Studie ermöglicht Einblicke in das vollständige Genom von Arten, die in einem der weltweit am stärksten bedrohten Biodiversitäts-Hotspots leben. Trotz der Bedeutung dieser megadiversen Regionen wie des Mata Atlântica sind solche Daten nur für eine sehr begrenzte Anzahl der dort vorkommenden Arten verfügbar. Die Arbeit liefert genetische Informationen, aus denen unmittelbar Maßnahmen für das Management gefährdeter Populationen abgeleitet werden können. Die Ergebnisse unterstreichen insbesondere die Dringlichkeit, die genetische Vielfalt zu erhalten, Inzucht zu verringern und die Fragmentierung der Lebensräume für das langfristige Überleben dieser Faultiere zu stoppen oder umzukehren.
„Die Erosion des Genoms stellt eine ernsthafte Bedrohung für Populationen dar, die unter Druck stehen, insbesondere angesichts zunehmender Inzucht. Dies ist eine klare Warnung, dass die Fragmentierung die Überlebenschancen des dieser Faultierarten verringert, insbesondere in der nördlichen Region von Bahia. Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit dem Instituto Tamanduá fortsetzen, um das Ausmaß der Auswirkungen auf die genomische Gesundheit dieser Arten zu bewerten“, sagt Camila Mazzoni, Gruppenleiterin für Evolutions- und Naturschutzgenomik am Leibniz-IZW und Senior-Autorin des Aufsatzes.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der brasilianische NGO Instituto Tamanduá sammelten nicht nur die Proben, die diese Genomstudie ermöglicht haben, sondern verfügen auch über jahrelange Erfahrung mit einer Vielzahl praktischer Maßnahmen zum Schutz dieser und anderer Arten von Faultieren und Ameisenbären. Von der Beschreibung einer neuen Faultierart bis zur Wiederherstellung ihres natürlichen Lebensraums durch Wiederaufforstung – alle Maßnahmen der Organisation sind wissenschaftlich fundiert und liefern neue wissenschaftliche Erkenntnisse, darunter auch Studien wie diese.